
Die Weihnacht des Christoph Groschau
VON THEODOR SEIDENFADEN
Eine Anekdote
Während der Jahre, die sich anschickten, den Deutschen den Titel ihres wahren Ruhmes zum alten Gerumpel zu werfen, die führenden Schichten also beginnen ließen, sich vom Volk der Denker und Dichter immer unerbittlicher in das der Erfinder, der Techniker und Ingenieure, der Konzernherrn zu verwandeln, lebte im letzten Fachwerkhause des damals fast unbekannten Gönnersdorf, einer Gemeinde des waldreichen Vinxtbachtales, der Hausierer Christoph Groschau, ein Hintersinniger. Er war ein kleiner buckliger und bartloser Mann, dem die Augenbrauen fast dicht über der willensstarken Nase 2usammengewachscn waren, das gerundete Kinn aber von einem weichen Gemüte sprach. Trotz seinem einträglichen Geschäft blieb er Junggeselle; denn es war ihm keine Frau begegnet, die das Zusammenleben mit einem Höckerigen hätte versuchen wollen, zumal es hieß, er sitze, wenn er nicht mit seiner Kiepe, deren Weiß- und Kurzwaren unterwegs sei — sie hatte er sich von einem Korbflechter dem Höcker gemäß anfertigen lassen —, mitunter bis tief in die Nacht zum Dreiarmleuchter bei roten Kerzen hinter merkwürdigen Büchern und spreche laut mit ihnen und sich selber. Sein Vater war schon Hausierer gewesen, aber gestorben, als er, der Christoph, der jüngste der fünf Söhne — außer ihm hatte keiner älter als acht, neun, zehn oder elf Monate werden können — eben ins fünfzehnte Jahr ging. Der alte Groschau, der unsäglich an dem Jungen hing, ihn nicht nur zur Schule geschickt, sondern dem Wißbegierigen durch einen weltgewandten älteren Lehrer aus Oberbreisig privaten Unterricht geben ließ, hatte, als er spürte, der Tod stehe an seinem Krankenbett, dem Sohn die Mutter, eine besinnliche Weinbauerntochter aus Dernau, anvertraut: er, der Christoph, müsse jetzt handeln gehen, damit Haus und Garten und das Geschäft und die Mutter erhalten blieben; höher als die Sonne, das solle er bei seinem Streben stets bedenken, fliege auch der Falke nicht; ein trockener Löffel kratze allerdings — das wisse er —, den Mund, bares Geld hingegen bleibe der Zauberer!

Den Unterricht hatte Christoph, nachdem der Vater begraben -war, aufstecken müssen: das Geschäft forderte seine volle Kraft, und als ihm, sechs Jahre später, auch die Mutter auf dem Schoof gelegen hatte, war er um fünfzehn Winter älter gewesen als andere Einundzwanzigjährige, und so hatte er sich zu dem Christoph Groschau entwickeln können, der, dreiundsechzigjährig, in seinem Fachwerk die seltsamste Weihnacht der Ahr feierte, die, zu erinnern, heute an der Zeit sein dürfte. Den Christoph Groschau hatte sein Geschäft nicht nur durch die Dörfer der Ahr geführt: es hatte ihn das Rheintal hinauf- und hinabgeschickt in die Eifel, den Westerwald und das Siebengebirge blicken und mit mehr Menschen zusammenkommen lassen als manchen Studierten, weshalb ihm sein Jahrhundert seltsam lebendig war. Was für eine Philosophie einer habe, hänge davon ab, was für ein Mensch er sei: dieser Satz Fichtes, den er aus dem Umgange mit dem Lehrer kannte und schätzte, war ihm neben den Grundsätzen vom Sterbebett seines Vaters Leitstern geblieben.

Nie hätte er, so bitter es ihm mitunter auch war, sich als Gezeichneten behaupten zu müssen, daran gedacht, sein Leben auszulöschen. Bei der Sonntagsmesse stand er zwar, wenn er nicht wanderte, stets hintenan, am liebsten in der dunkelsten Ecke der Kirche. Gott aber war ihm ewiges Leben, ob er den Kerzenschein des Altares, die Wingerte der Ahr, den Sinziger Staufer-Dom, die Schiffe auf dem Rhein, eine Rose oder einen Wurm sah, und so blieb es ihm nicht verborgen, in welchem Maße Redlichkeit und Reinheit trotz den Frömmlern, die er nicht mochte, schwanden. Er spürte, wie um ihn, den höckerigen Händler, der es ehrlich meinte, das wuchs, was Masse genannt wird, sich demnach eine Endezeit vorbereite, die Schreckliches auslösen werde, wie er es sich bei seinen einsamen Kiepengängen gestand. Er hatte erlebt, wie das Wilhelminische Kaiserreich, eine mächtige Konstruktion Bismarcks, verfassungsmäßig durch das Übergewicht Preußens verankert, gestützt auf Heer und Beamtentum, eine Welt festgeschriebener und ungeschriebener Rangordnungen und Regeln war, wie jedoch dieses Reich völlig veräußerlichte, es zwar das Erinnern an seine toten Dichter oder den von ihm verehrten Fichte und anderer Denker feierte, nicht jedoch nach deren Gesetzen lebte, wie man den Sedan- und den Reichsgründungtag als nationale Triumphe begehe, den Lärm liebe und eigentlich das Geheimnis des Mensch-Seins verliere, das sein Vater und seine stille Mutter ihm, dem Buckel, vermacht hätten!
Das, woran er litt — der Höcker — war ihm zwar ein Hindernis des Körpers, nicht aber eines des Willens. Er wußte, daß der hüftlahme Schleiermacher, den er las, aus tiefstem Leid das Wort geprägt habe: „Wir können uns nicht genug waffnen gegen die zauberische Macht von Worten, Namen und Bildern." Ihn biß es, wenn er bei seinen Gängen mit der Kiepe hin und wieder das Wort hören mußte, das hinter ihm herflüsterte: mancher hätte einen Buckel, nur wisse man nicht, wo er sitze! Es hatte lange gedauert, bis er aufhörte, sich als einen Stiefsohn der Natur zu betrachten, und doch blieb ihm stets das Erkennen bewußt, das einen Tauben sagen lasse, er könne gut hören, einen Klumpfuß zwinge, über rauhe Wege zu gehen, den Schwachen nötige, seine Stärke zu Zeigen.
Christoph Groschau wußte, wie gesagt, daß er nicht zuletzt dem Buckel die Spannkraft seines Geistes zu danken habe; er wußte, daß Alexander der Große klein und schiefhalsig, Napoleon I. nicht groß und häßlich gewesen sei; ja — er hatte von dem schiefschultrigen Voltaire, dem eitlen Franzosen-Dichter, dem buckligen Philosophen Moses Mendelssohn, dem mißgestalteten Aphorismendichter Lichtenberg und dem halblahmen Freischütz-Komponisten Carl Maria von Weber gelesen, sich jedoch durchgerungen zu dem Bekennen: der Triumph der Seele über die Mißhelligkeiten des Körpers beweise sich als das Höchste des Lebens!
Sein Guthaben auf der Kreissparkasse war nicht gering, weshalb die Großhändler ihm vertrauten, und das Fachwerkhaus blieb ihm blitzsauber, der Garten gepflegt, auch mit wechselnden Blumen, obwohl er nie fremde Hilfe beanspruchte.
Der dreiundsechzigste Spätherbst seines Daseins aber setzte ihm so zu, daß es ihm unmöglich war, mit der Kiepe zu wandern, er gar vom zweiten Advent an fast immer liegen mußte, nachdem er die nächste Nachbarin gebeten hatte, die halbtaube Witwe Annegret, die bei ihrer verheirateten Tochter den Lebensabend verbrachte, immer noch rüstig zu häuslichen Dingen, gegen Entgelt täglich nach ihm zu sehen.

Bei ihren warmen Suppen und ihrem stummen Hantieren kehrten dem Christoph Groschau die Lebensgeister wieder zurück, und er war am vierten Advent scheinbar genesen, blieb auf und tat, was zu tun nötig war, allein, und da es unausgesetzt schneite, blieb die zweiundsiebzigjährige Annegret gern hinter dem warmen Ofen in der Wohnstube ihrer Tochter.
Christoph Groschau aber, der mit geschlagenem Holz und Lebensmitteln eingedeckt war — die älteste Enkelin der Annegret brachte ihm täglich ein Liter guter Kuhmilch und tat es gern der Pfennige wegen, die ihr der Christoph Groschau über den ausbedungenen Preis hinaus schenkte —, lebte er die drei Tage bis zum Heiligen Abend mit den ihm vertrauten Geistern seiner abgegriffenen Bücher geradezu das umsponnene Dasein eines Verklärten. Er schrieb dazu auf lose Blätter eines auseinandergetrennten Schulheftes langsam und umständlich, was ihn bewegte und hatte das Gefühl, das Geschriebene auf dem liniierten Papier sei sein Testament.
Während der Nacht aber, die dem Heiligen Abend folgte, machte er unter das Geschriebene einen nur ihm geläufigen Schlußstrich, indes die drei Kerzen des Leuchters — er hatte die abgebrannten zuvor durch frische ersetzt —, zutraulich brannten, wie wenn ihr Licht ihm das hätte geben wollen, was er seit dem Tode von Vater und Mutter entbehrt und darum gesucht hatte: die Liebe des Behütenden. Dann überkam ihn eine Schwäche, so daß er sich in seinen Sessel zurücklehnen, die Augen schließen und glauben mußte, gütige Hände trügen ihn aus dem Dasein der Kümmernisse dem Reiche einer goldenen Stille zu.
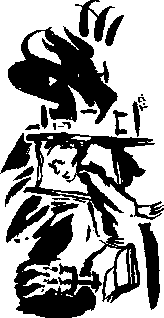
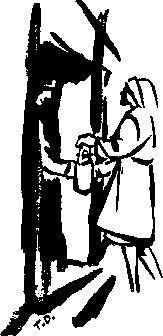
Die Gönersdorfer aber, die mit kleinen Laternen aus ihren Häusern kamen und, den Glocken folgend, zur Christmette gingen, der Kirche entgegen, schraken plötzlich auf: aus der Richtung des letzten Fachwerkes fiel ein Flammenschein, der das Dunkel gespenstisch erhellte, und die Männer liefen statt zur Kirche dem Brande zu.
Die Flammen schlugen aus dem unteren Fenster, und als die Männer die Tür aufgestoßen hatten und sie den Christoph Groschau, raucherstickt im Sessel seiner Wohnstube hintenüber lehnen, seine Kerzen aber brennen sahen, stellten sie fest, Funken des kleinen eisernen Ofens müßten das vor seinem Aschenloch aufgestapelte Holz entzündet und so den Brand verursacht haben, der auf das Bett und von ihm aus zu den kleinen Gardinen des Fensters gesprungen sei. Es erübrigt sich, zu schildern, wie man den Christoph Groschau und die vor ihm liegenden Papiere in das Haus der taubstummen Annegret brachte, wie die Christglocken Sturm läuteten und alles geschah, den Brand zu löschen, was bei dem Schneewetter nicht gerade einfach war. Daß die Christmette erst begann, als es keine Gefahr des Funkensprunges mehr gab, sei noch bemerkt.
Entscheidend ist jedoch, festzustellen, was der Christoph Groschau den losen Blättern anvertraut hatte.
Die Wirren der beiden Weltkriege, die seinem Ahnen vom Ende der Dinge recht gaben, ließen sie verloren gehen. Ihre entscheidenden Sätze aber leben dem Erinnern noch heute, und sie lauten: der Hausierer Christoph Groschau wolle zwischen Vater und Mutter bestattet werden; den Grabplatz habe er gleich damals, als der Vater fortgegangen sei, gekauft und bezahlt; die Obrigkeit solle sein Vermögen Krüppeln zukommen lassen; der halbtauben Annegret, der Witwe, die ihm während seiner kranken Wochen geholfen habe, seien, so lang sie lebe, aus ihm monatlich zehn Goldmark zu zahlen; ob man ein Wuchs- oder ein Häßlichkeit-Krüppel sei: der Hang zur Einsamkeit könne morden; wer aber um das Sehnen nach Liebe wisse, der ahne das Leid des Krüppels!