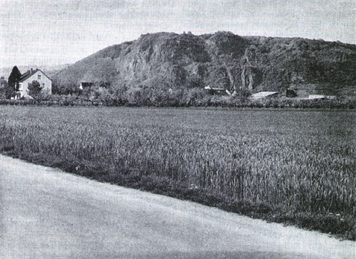
Remagener Gräberfelder in germanisch-römischer Zeit
VON BERNHARD KOSSMANN
Das innere Wesen unserer germanischen Vorfahren tritt uns in vielen Beziehungen höchst anschaulich in seinem religiösen Leben entgegen. Ihr Seelen- und Götterglauben verbindet sich fest mit den seelischen Einflüssen der furchterregenden Naturgewalten. Wie bei den meisten Völkern wirkt zunächst das Geheimnis des Todes als Anstoß zu „mystischem" Denken, zum Gottsuchen. Die Seelen der Toten leben fort, daher der Totenkult, von dem vielleicht aller Kult ausgeht. Daher die uralten mannigfachen Beigaben in den Gräbern, Gebrauchs- und Schmuckgegenstände des Toten für sein Weiterleben, daher die Darbietung von Speise und Trank, die Totenopfer und Leichenschmäuse (Abschiedsmähler), die während des Leichenbrandes stattfanden, daher die Totenwachen — zur Abwehr der Seele. Den Tod fürchtete der Germane selbst überhaupt nicht: das zeigt schon seine Todesfreudigkeit in der Schlacht. Dagegen fürchteten die Lebenden die Toten. Der Tote sollte völlig unschädlich werden, damit er nicht wiederkehre, was man beim Begraben auch schon durch Bepacken mit schweren Steinen zu erreichen suchte.
In der jüngeren Steinzeit (etwa 3000—1800 v. Chr.) errichtete man über der Erde Grabbauten aus gewaltigen Steinen zu Steinkammern (Hünengräber). Diese Megalithgräber wichen in der vorgeschrittenen Bronzezeit, etwa 1800—800 v. Chr., den Hügelgräbern mit den meist in Hockstellung gefesselten Leichnamen.
Bei den klassischen Völkern haben Begräbnis und Leichenbrand gewechselt. Griechen und Römer begruben ihre Toten zuerst, dann kam unter griechischem Einfluß bei den Römern wieder Leichenbrand auf. Daneben setzte sich aus gesteigerter Pietät gegen den Verstorbenen, wie man meint, wieder aufs neue das Begräbnis durch.
Bei unseren Vorfahren, den Germanen, wurden in der ältesten Zeit die Leichen ebenfalls unverbrannt bestattet. Leichenbrand kam aber schon vereinzelt von Süd- und Mitteleuropa her gegen Ende der Steinzeit in Gebrauch, breitete sich in der älteren Bronzezeit aus und wurde in der jüngeren Bronzezeit, etwa 800 v. Chr., allgemein. Von den Kelten her drang in der jüngeren Eisenzeit, der La-Tene-Zeit, etwa 500—o v. Chr., wieder die Beerdigung ein. Doch blieb auch die Verbrennung noch lange Zeit üblich. Die Leichen wurden auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Wie ausgeglühte Nägel und Metallteile bezeugen, beförderte man sie auf zusammengenagelten Brettern oder in Särgen zur Brandstelle. Zum Scheiterhaufen, der oft riesige Dimensionen annahm, wurden verschiedene Hölzer benutzt. Man bevorzugte, wie Bodenfunde beweisen, Eiche, Buche, Kiefer und Wacholder. Die nächsten Angehörigen zündeten mit abgewendetem Antlitz das Feuer an, während bei dem üblichen Trauerzeremoniell gleichzeitig Trauergesänge erklangen. Wenn das Feuer niedergebrannt und die glühende Asche gelöscht war, sammelte man die gesamten Rückstände, wie Leichenbrand, Holzkohle, Gefäß- und Metallreste meist in wirrem Durcheinander zur Beisetzung. Bei einer anderen Art der Verbrennung wurde der Tote auf einer Kline (Speisesofa) liegend über einem Bustum (Leichenbrandgrube) eingeäschert. Dabei wurden Leichnam und Scheiterhaufen über der Grube aufgebaut. So fielen bei der Verbrennung die Rückstände des Feuers und die Asche des Verstorbenen sofort in die Grube. Nicht selten führten zu solchen Gruben aus Ziegeln gebaute Luftkanäle. Es ist anzunehmen, daß einige Busta auch als öffentliche kleine „Krematorien" benutzt wurden. Oft setzte man die Brandreste der Leichen und der Beigaben in Holzsärgen oder Steinkisten in einem Grabhügel bei. Dann kam die Urne auf, um in ihr die Brandreste zu sammeln. Auch sie umpackte man anfangs mit Steinen oder legte solche darüber. Allmählich verschwanden die Hügelgräber, in denen man anfangs auch die Urnen bettete, und es entstanden Urnenfriedhöfe, die in der Eisenzeit allgemein wurden. Im Nordosten ist man dann von der Urne abgekommen, und man sammelte die Reste in bloßen Brandgruben, eine Sitte, die schließlich nach dem Westen vordrang. Manchmal grub man nur ein kleines Grübchen für ein Brandschüttungsgrab, oder man machte runde oder ovale kesseiförmige Vertiefungen bis zu 60 cm für die Brandgrubengräber.
Man betrachtete das Grab jetzt als nunmehrige Wohnung des Toten, in der er weiter lebte. Hieraus entstand die Sitte, Gegenstände, deren der Verstorbene auf Erden bedurfte oder an denen sein Sinn besonders hing, ihm mit ins Grab zu geben. So fehlten dann kaum in dem bescheidensten Grabe solche Gaben der Liebe.
Der römische Philosoph und Historiker Taci-tus (etwa 55—116 n. Chr.) berichtete in seiner kleinen Studie „Germania" über Ursprung, Lage, Sitten und Völker der Germanen. Im 27. Kapitel schreibt er über die „Totenbestattung" eines weniger begüterten Germanen. „Bei den Leichenbegängnissen herrscht keinerlei Gepränge", wie es bei den Kelten und Römern üblich war. „Der Scheiterhaufen wird nicht mit Teppichen und Räucherwerk überladen. Hochragende, kunstvolle Gedenkmaler werden vermieden, sie erscheinen den Germanen als eine Last, nicht als eine Ehrung. Das Klagen und Weinen währt nur kurz, Schmerz und Gram halten lange an. Für eine Frau schickt sich sichtbare Trauer, für den Mann ein treues Gedenken." Die lebendigste Schilderung einer germanischen Totenfeier besitzen wir in dem Heldengedicht vom König „Beowulf". Es hat sich im alten England als Restgut aus der Frühzeit der Angelsachsen erhalten.
Obwohl das Gedicht erst im 10. Jahrhundert aufgezeichnet wurde, stammt die Urgestalt wohl aus dem 7. Jahrhundert. Es schildert anschaulich die zehntägige Feier der Verbrennung und Bestattung des alten Königs, der nach dem Kampf mit dem Drachen den Wunden erliegt und von seinen Helden bestattet wird.
In unserer Heimat fanden wir auf den Begräbnisplätzen der vorchristlichen und römischen Besatzungszeit bis zum Vordringen des Christentums im 5. Jahrhundert als Regel die Flachgräber, also Gräber der „Brandgrubenkultur".
Doch ist im Verborgenen die Leichenverbrennung noch weiter geübt worden. Es ist bekannt, daß Karl der Große (768—814) nach der Besiegung des Sachsenvolkes diese Bestattungsart durch das erste Gesetzbuch der fränkischen Könige, der sogenannten „lex sa-lica", unter Strafandrohung abschaffte.
Als Julius Cäsar im Jahre 55 v. Chr. als Eroberer Galliens an den Rhein kam und den Strom zur Grenze des römischen Imperiums machte, lebte in unserer Heimat das gallisch-germanische Mischvolk der „Eburonen". Nach Cäsar, „Der Gallische Krieg", dehnte es sich zwischen Rhein und Maas aus mit wahrscheinlicher Südgrenze am Vinxtbach unterhalb Brohl. Das Volk stand unter der Herrschaft des Ambiorix und Catuvolcus. Im Winter 54/53 v. Chr. warfen sie sich den Truppen Cäsars in den Winterlagern entgegen und suchten vergeblich, die Unterwerfung des Landes zu verhindern, Cäsar übte Vergeltung und rottete, wie berichtet wird, das Eburonenvolk vollständig aus. Wer seinem Strafgericht entkam, ging wahrscheinlich in dem Stamm der Ubier auf, dem die entvölkerten Wohngebiete unserer Heimat in den dreißiger Jahren vor Christus als neuer Lebensraum zugewiesen wurde.
Als Drusus im Jahre 12 v. Chr. die Germanenkriege begann, schuf er zu seinem rheinischen Offensivgürtel auch ein kurzlebiges Erdlager in Remagen. Das Holz-Erde-Kastell „Rigomagus" wurde um das Jahr 16 n. Chr. von Kaiser Tiberius (14—37) angelegt. Es war ein Kohortenlager mit durchschnittlich 360 bis 500 Mann Besatzung. Es waren einheimische Auxiliartruppen (Hilfssoldaten) unter dem Kommando eines Römers.
So lebte in Remagen, wie auch Grabsteine bezeugen, während der römischen Besatzungszeit eine bunte Völkermischung aus Soldaten und Zivilisten: Kelten, freie und romanisierte Germanen, römische Legionäre und Söldner als Hilfstruppen und Benefiziarier als Hüter der Straßenordnung und Bewachung.
Ein Teil der Remagener Bevölkerung wird sich nach und nach auf die Versorgung dieser Truppen mit Lebens- und Bedarfsmitteln eingestellt haben.
Bei den engen Beziehungen der Bevölkerung zu der Besatzungstruppe ist anzunehmen, daß Zivilisten und Soldaten auch gemeinsam auf unseren Gräberfeldern bestattet wurden.
Die Arbeitseinheiten für die Truppen wurden teils im Kastell selbst aufgenommen. Die feuergefährlichen Betriebe, wie Schmiede, Töpfer und Ziegler, siedelte man in späterer Zeit in Vierteln außerhalb des Lagers an. Darauf deuten die ausgegrabenen Topföfen der Hündelgasse, der Postgasse und die Funde in den Kellerräumen der früheren Weinhandlung Caracciola.
Das Kastell und deren Vorstadt (Auxiliarvi-cus) waren eng miteinander verbunden; sie lagen auf militärischem Territorium. Die Bewohner mußten das römische Bürgerrecht besitzen.
Die benachbarte bürgerliche Siedlung lag außerhalb des Lagers und war davon räumlich und eigentumsrechtlich getrennt. In dieser Siedlung konnten sich die Zivilisten anbauen, freien Handel treiben oder den Ertrag ihres Handwerks frei verkaufen. Viele Ländereien waren kaiserlicher Grundbesitz. Einige kleine Farmhäuser oder Höfe, die in Remagen bis zum „Alten Fuhrweg" ausgegraben wurden, gehörten wohl Zivilisten, vor allem aber ausgedienten Soldaten.
Nach dem „Zwölftafelgesetz", der ersten Gesetzesaufzeichnung der Römer um das Jahr 451 v. Chr., war es verboten, einen Toten in der Stadt oder Siedlung zu verbrennen oder zu begraben.
Auch die in Remagen entdeckten Friedhöfe lagen größtenteils weit ab vom Kastell und der bürgerlichen Siedlung. Nördlich und südlich des Ortes säumten sie die Heerstraße, die über den damaligen Niederterrassenrand das ganze System militärischer Anlagen am Rhein entlang verband.
Diese Militärstraße führt, von Norden kommend, über die Fürstenbergstraße, Bach-, Hauptstraße bis zum heutigen St. Annakloster. Unter dem Namen „Alte Straße" verläuft sie bis zur Gabelung am „Wickels-mäuerchen", einer alten Ortsbezeichnung des vorigen Jahrhunderts. Eine Mauer entlang der Goethestraße glich den Höhenunterschied mit der Römerstraße aus.
Die Römerstraße erstreckt sich dann in gerader südlicher Richtung, überquert die Sinzig-Kripper Landstraße, die römische Ahrbrücke mit den steinernen Brückenköpfen (entdeckt 1886 von Heinrich Reuleaux aus Remagen, t 1899, und Prof. Klein, Bonn) und mündet durch die Sinziger Flur kurz unterhalb Niederbreisig.
Diese „Römerstraße" von der Gabelung „Wickelsmäuerchen" ab nach Süden war die Hauptgräberstraße in vorchristlicher Zeit und während der römischen Besatzung. Sie liegt nur einige hundert Meter von unseren modernen Friedhöfen der Neuzeit entfernt. Weil die zu beschreibenden Gräberfelder bis 1,5 km vom Kastell entfernt sind, nahm man zuerst an, daß der große Begräbnisplatz nicht zu dem Remagener Kastell und seiner bürgerlichen Niederlassung gehörte, sondern zu einer mehr rheinaufwärts gelegenen Ansiedlung.
Nachdem man aber durch Versuchsgrabungen keine dem Kastell näher gelegenen Friedhöfe fand, dabei auch noch weit nach Süden hin Fundamente römischer Villen anschnitt, stand fest, daß die Friedhöfe an der Römerstraße zum Kastell und seinem vicus (Dorf) gehörten.
In der Landzunge "Wickelsmäuerchen", die innerhalb der Gabelung Römer-/Goethestraße liegt, stieß man bei der Aushebung einer Grube zur Sandgewinnung auf Skelett- und Brandgräber in einem Flächenraum von etwa 1800 qm. Es handelte sich bei den Skelettgräbern um Erwachsene und Kinder, die meist 1—1,5 m bis auf die Sandschicht versenkt waren. Dabei hatte man wohl das Bestreben, der Leiche eine längere Erhaltung zu sichern. Die Skelette waren, was Schädel und Zähne betrifft, auch gut erhalten,
Leichenbestattungen erfolgten meist in Holzsärgen. Die schweren Nägel, die man bei den Grabungen fand, deuten wohl auf Särge von Holzbohlen hin, kleinere lassen auf Brettersärge schließen.
Daneben waren auch einige Leichen in sogenannten Plattengräbern beerdigt. Dabei handelt es sich um einen Grabbau mit Ziegelplatten von etwa 42 x 50 x 6,5 cm Größe und mehr. Boden und Seitenwände wurden mit den Platten ausgelegt. Pultdach mit römischen Dachpfannen und Firsthohlziegeln bildeten oben den Abschluß. Für den Toten soll der Bau wohl eine Nachbildung der Wohnung bei Lebzeiten bedeuten. Die Beigaben — Krug, Urne, Schale — lagen meist zu Füßen der Skelette, auch neben und unterhalb der rechten Schulter.
Bei den Brandgräbern fand man Aschenurnen, Tonschalen und Glasgefäße. An Bronzestücken waren Fibeln, Pinzette, Gewandnadeln und Armringe beigegeben. Doch machten die Beigaben den Eindruck, als sei der Volksfriedhof für Leichen armer Leute bestimmt gewesen.
Man entdeckte hier über 100 Gräber. Die Zahl wäre noch viel größer gewesen, wenn nicht schon eine Ausbeutung durch fremde „Unternehmer" vorangegangen wäre.
Nach der Art der Keramik und der Metallfunde wurde dieser Friedhof gleich mit Tiberius (14—17 n. Chr.) belegt, reichte aber nicht über die Mitte des 3. Jahrhunderts hinaus.
Das Bonner Provinzialmuseum stellte schon im Jahre 1886 bei einer Kellerausschachtung am Rande des Hauptgräberfeldes auf der Rheinseite der Römerstraße eine Anzahl Urnengräber sicher, die aus einer noch früheren Zeit stammten, wohl aus der Zeit des Kaisers Augustus um die Wende der Zeitrechnung. Diese Urnen standen im Lehmboden in 3—4 m Abstand und einer Tiefe von So bis 100 cm.
Nach einer Grabenspause von 15 Jahren wurde die Aufmerksamkeit auf ein mehr südlich der Römerstraße gelegenes Gräberzentrum gelenkt. Schon längere Zeit beobachtete man, daß durch tiefes Pflügen der Felder immer mehr römische Gefäßscherben und Dachziegelstücke zum Vorschein kamen. Um weitere Zerstörungen und Ausbeutungen zu unterbinden, beschloß die Stadtverwaltung von Remagen unter dem Bürgermeister Peter Wilhelm Hoeren (1892—1918), die Ausgrabungen selbst zu übernehmen. Die Leitung übertrug man dem Apotheker Eugen Funk, der mit viel archäologischen Kenntnissen und Umsicht die Grabungen des neuen Gräberfeldes in zwei Abschnitten von 1901 bis 1905 ausführte.
Durch Versuchsgrabungen hatte man vorher festgestellt, daß auf der ganzen Rheinseite der Römerstraße vom Wickelsmäuerchen bis zum Römerhof Brandgräber vorhanden waren. Doch waren sie nicht gleichmäßig verteilt. Ungefähr 500 m von dem Friedhof am Wickelsmäuerchen stellte man das dicht belegte Gräberzentrum fest.
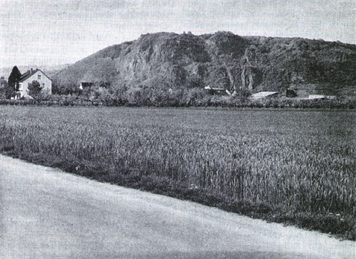
Römisch-germanischer
Urnen- und Brandgräberfriedhof an der Römerstraße
Foto: Stang
Man fand hier ausschließlich Brandgräber, und es war auffallend, daß man nicht auf Skelette stieß. Irgendeine reihenweise Ordnung der Gräber war nicht festzustellen. Der Straße entlang war die Belegung am dichtesten, 100 m feldeinwärts war sie geringer. Es war ein Areal von etwa 3200 qm, das systematisch durchgraben wurde.
Frühe und spätere Gräber wechselten in bunter Reihenfolge. Man hat offenbar die alten Begräbnisplätze für weitere Bestattungen wieder benutzt. Zwölf Gräber fand man, deren Wände versiegelt waren durch Leichenverbrennung in der Grube selbst. Der Allgemeinheit dienten wohl zwei größere Brandgruben als Krematorien. Deren Größenmaße betrugen 2 x 1,60 und 2 x 2 m, die Sohlentiefe war für beide etwa 0,70 m. Auffallend war auch die verschiedene Tiefenlage der Gräber, denn nebeneinander liegende Grabstellen wechselten oft ab in Tiefen von 0,25 bis i m und mehr. Ob es reine Willkür war, oder die Erosion durch Rhein und Ahr eine Rolle spielte, ist nicht leicht festzustellen. Es kam vor, daß im Boden freistehende Gefäße mit ihrem abgebrochenen Hals die heutige Oberfläche des Bodens überragten. Dies ist nur zu erklären durch eine Niveauänderung des Gräberfeldes durch alte Rheinläufe und Hochfluten von Rhein und Ahr im Laufe der Jahrhunderte.
Alte Flurnamen geben uns noch Auskunft über den früheren Zustand unseres römischen Friedhofsgeländes. Die Distriktnamen „im Wasserloch", „in der Kaul", im „Pölchen" geben Sümpfe an in der Rheinebene. Auch in der höher gelegenen Flur, wozu auch unser Gräberfeld gehört, deuten Namen wie in der „Herskaul", „am Schwenkgraben" und „im Mär" auf sumpfiges Gebiet bzw. Wasserstellen hin. Deshalb wurde das heute so fruchtbare Ackerbaugebiet früher hauptsächlich als Viehweiden benutzt, wie Flurnamen „auf den Rinderweiden" und „am Anger" bezeugen.
Durch frühere Regulierungen von Rhein und Ahr in Verbindung mit dem Dammbau „Im Sand" im Jahre 1884 durch Bürgermeister von Lassaulx (1879—1892) ist das alte Gräberfeld, das heutige Ackerbaugebiet der Goldenen Meile, gegen Überschwemmungen mehr gesichert.
Nach den mehrjährigen Grabungen zählte man über 200 Brandgräber mit mehr als 500 Beigaben (Keramik, Glas, Bronze, Eisen, Schmucksachen). Die Grabbeigaben von etwa aoo Einzelgräbern wurden nummeriert in den Glasschränken des 1905 neugegründeten Museums der Öffentlichkeit gezeigt. Besonders reich waren die keramischen Gefäße heimischen Ursprungs vertreten. Ein Teil der gröberen, rauhwandigen Tonwaren wurde in den Remagener Brennöfen der Hündels- und Postgasse gebrannt. Auf dem Marktplatz, hinter dem Marienbrunnen, grub man eine Töpferei aus, die vornehme schwarz gefärbte „Terra nigra", aber auch orangerote und braun gefärbte Ware des i. Jahrhunderts anfertigte. Reste von beiden Brennstellen wurden vor der Jahrhundertwende entdeckt.
Oberhalb der Ahrmündung, heute auf Sinziger Gebiet, war im 2. Jahrhundert ein ausgedehnter Fabrikbetrieb mit großen und kleinen Brennöfen zur Versorgung der Truppen und Zivilisten. Hier wurde außer den roten Ziegelsteinen auch tägl. Gebrauchsgeschirr und gute römische Tafelkeramik aus einem fein geschlemmten Ton, der „Terra sigillata", gebrannt.
Bedeutungsvoll waren die gefundenen Formschüsseln mit den mannigfachen eingepreßten Negativen von Bildern und Herstellernamen. Etwa 24 Meisterbetriebe waren so auf den als Grabbeigaben gefundenen Amphoren, Schüsseln, Tellern, Krügen, Bechern und Tonlämpchen gekennzeichnet. Wir lesen als häufiger vorkommende Namensstempel:
RVPIN, OF (ficina = Werkstätte) VITAL, Afer-FECIT, COSIRVS, CINTVGNA, AFIMETI, OFI - FABV, COSRVE, MILISIVS u. a.
Der Archäologe schließt aus der Fülle des Materials auf die Lebensgewohnheiten des Verstorbenen, seine Herkunft, sein Geschlecht, die soziale Stellung, manchmal auch auf die Zeit und Dauer seines irdischen Daseins.
Wenn Handwerkszeuge wie Messer, Stahl und Schleifstein in einem Grab gefunden werden, dann deutet dies bestimmt auf eine handwerkliche Beschäftigung eines Mannes hin. Die Lieblingsbeschäftigung soll auch im Jenseits fortgesetzt werden. Bei einem anderen Grab lag neben einer Fortuna-Statuette ein ganzes Würfelspiel. Der Verstorbene hat wohl mit Hilfe der Göttin viel Glück im Leben gehabt, und so soll im Jenseits das Glücksspiel weiter gepflegt werden.
Kostbare Amphoren und reichverzierte Gläser, die vorher das Heim der Toten geziert haben, deuten auf eine gehobene soziale Stellung hin.
Säbel, Lanzenspitze und Schaft lassen das Grab eines germanischen Kriegers erkennen. Bei einem Römer war es nicht Brauch, mit einer Waffe begraben zu werden.
Bei einem anderen Grab bestand die Absicht, dem Verstorbenen seine irdische Wohnung nachzubilden. Mit unserem heutigen Wohnhaus zu vergleichen, war es ein 75 cm langes Häuschen mit einem Stockwerk und einem Dachspeicher. Das Dach war mit Falzziegeln gedeckt. Im Speicherraum stand ein weißer Henkelkrug mit einer terra-sigillata-Kumpe. Die untere Etage barg einen Sigillata-Teller mit Knochenresten zur Speisung und eine große Urne, mit mächtigen Knochen gefüllt. Mit besonderer Liebe hatten Eltern das Grab eines Kindes hergerichtet. Neben dem kleinen Häuflein Asche stand ein kleines tönernes Schäfchen. Wenn es geschüttelt wurde, erklangen kleine Steinchen im Innern wie eine Kinderrassel. Es war wohl das letzte Kinderspielzeug, das dem Kinde ins jenseitige Leben folgen soll.